Erhard Schneckenburger

Verfolgung
Juni 1933
Schneckenburger besitzt eine Sammlung von sozialistischen und marxistischen Büchern. Weil er befürchtet, die NS-Behörden könnten seine Wohnung durchsuchen, bewahrt er nur wenige Bücher in seiner Wohnung auf. Die restlichen Bücher versteckt er im Holzschuppen seiner Schwiegermutter in Stuttgart-Botnang. Im Juni 1933 wird Schneckenburgers Wohnung von zwei Gestapo-Beamten durchsucht. Dabei werden die in der Wohnung gefundenen Bücher beschlagnahmt. Nach der Durchsuchung beschließt Schneckenburger, die bei seiner Schwiegermutter gelagerten Bücher zu entsorgen. Er verbrennt die Bücher in der Waschküche seiner Schwiegermutter und spült die Asche in den Abfluss. Die große Aschemenge verstopft jedoch den Abfluss, der daraufhin ausgegraben und gereinigt werden muss.
16.10.1933
Schneckenburger ist Hauptlehrer an der Volksschule in Stuttgart-Botnang. Am 16. Oktober 1933 wird er aus politischen Gründen aus dem württembergischen Schuldienst entlassen. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.
Biografie
Bürgerschule in Stuttgart
Präparandenanstalt und Lehrerseminar in Backnang
November 1914
Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen
1914
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg
ab Mai 1917
Vertretungslehrer an verschiedenen württembergischen Schulen, anschließend Hauptlehrer in Stuttgart-Botnang
1919
Eintritt in die KPD
1920
Eintritt in die SPD
Mitglied des Vorstands des SPD-Ortvereins Botnang
1920
Erfolglose Kandidatur für den Reichstag und den württembergischen Landtag
August 1920
Gegen Schneckenburger wird eine Disziplinaruntersuchung durchgeführt. Ihm wird kommunistische Propaganda im Schuldienst vorgeworfen. Die Untersuchung wird ergebnislos eingestellt.
Dezember 1920
Mitglied im Verein für Jugendkunde und Lehrerfortbildung
Mitgründer der Deutschen Kinderfreundebewegung
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Lehrer und Lehrerinnen
Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold
ab 1928
Mitglied im Gemeinderat in Stuttgart
ab Februar 1929
Lehrer an der Volksschule in Stuttgart
1933
Vertreter einer Wäschefirma und kaufmännischer Angestellter bei der Firma Nanz
Juni 1934
Angestellter bei der Firma Bosch in Stuttgart
Juli 1942
Erneut Lehrer im württembergischen Staatsdienst (vermutlich aufgrund des kriegsbedingten Lehrermangels)
ab 1945
Leiter der Abteilung für die Volks-, Mittel- und Sonderschulen im Kultministerium von Württemberg-Baden, später im Kultusministerium Baden-Württemberg, zunächst als Ministerialrat, ab 1951 als Ministerialdirigent und ab 1959 als Ministerialdirektor
Literatur
Karl Bayer: »Nicht das Ich, sondern das Wir...«. 100 Jahre SPD in Botnang. 1890-1990, Stuttgart 1990, S. 48-50.
Andreas Gestrich: »Aufwiegler, Rebellen, saubere Buben«. Alltag in Botnang. Geschichte eines Stuttgarter Stadtteils, Stuttgart 1994, S. 243-245, 269-270.
Schröder 1995, S. 729.
Mittag 1997, S. 182.
Raberg 2001, S. 812.
Weik 2003, S. 133.
Dokumente
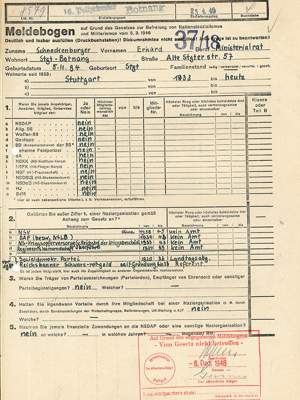
Meldebogen zur Entnazifizierung
Im Rahmen der nach 1945 durchgeführten Entnazifizierung musste Schneckenburger - wie jede und jeder Deutsche über 18 Jahren - in einem Meldebogen seine eventuelle Zugehörigkeit zu NS-Organisationen und seine Aktivitäten in der NS-Zeit darlegen. Ziel dieser Maßnahme war es, NS-Täter und belastete Personen zu finden, aus öffentlichen Ämtern und Behörden zu entfernen und gegebenenfalls zur Rechenschaft zu ziehen.