Interview mit Ulrich Mendelin in der Schwäbischen Zeitung
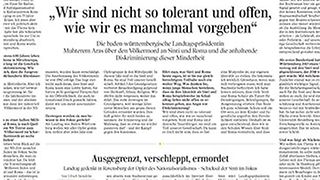
"Wir sind nicht so tolerant und offen, wie wir es manchmal vorgeben"
Von Ulrich Mendelin
Wie sind Sie zum ersten Mal mit Sinti und Roma, mit ihrer Kultur und Geschichte in Berührung gekommen?
In meiner politischen Arbeit, und dann vor allem als Präsidentin des Landtags, habe ich mich stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung mit dem grünen Europa-Abgeordneten Romeo Franz in Mannheim, im Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung, dem Kulturzentrum RomnoKher. Da ging es um 75 Jahre Auschwitz-Erlass. Ich muss aber zugeben, bevor ich politisch aktiv wurde, war mir das Thema kein Begriff. Ich habe fast alle Schularten von der Hauptschule bis zur Uni in Baden-Württemberg absolviert, aber über Sinti und Roma wurde nirgends gesprochen.
Seit mindestens 600 Jahren leben Sinti und Roma in Mitteleuropa, und ebenso lang ist die Geschichte ihrer Diskriminierung. Wie erklärt es sich, dass die Ausgrenzung die Jahrhunderte überdauerte?
Ich bin keine Historikerin. Aber ich war erschrocken, wie tief verwurzelt diese Ausgrenzung ist. Sie wurde über die Jahrhunderte immer schlimmer, und der absolute Tiefpunkt war dann der industriell betriebene Völkermord in der NS-Zeit.
250.000 bis zu einer halben Million Sinti und Roma, je nach Quelle, fielen dem NS-Terror zum Opfer. Ein Völkermord im Schatten des Völkermords an sechs Millionen Juden?
Natürlich stehen beim Blick auf die Verfolgten der NS-Zeit zunächst einmal die Juden im Fokus. Sechs Millionen Menschen, die man industriell vernichtet hat. Da fehlt einem jegliche Vorstellungskraft. Aber sechs Millionen Juden und 500.000 Sinti und Roma – das ist ja nicht gegeneinander aufzuwiegen. Die Nazis wollten beide Gemeinschaften auslöschen, und das aus denselben rassenideologischen Gründen. Deswegen finde ich, man hätte sich schon früher intensiv mit dem Völkermord an den Sinti und Roma auseinandersetzen müssen.
Stattdessen hat der Bundesgerichtshof 1956 Entschädigungen für Sinti und Roma für die Zeit vor dem so genannten Auschwitz-Befehl von 1942 abgelehnt. Also auch für die Menschen, die ab 1937 in Ravensburg und anderswo in Zwangslager gebracht wurden ...
Die Begründung war, die Verfolgung sei ja nicht aus rassistischen Gründen geschehen, sondern wegen angeblicher asozialer Eigenschaften dieser Volksgruppe. Das ist schon erschreckend, dass wir als Bundesrepublik den Völkermord so lange gar nicht anerkannt haben. Menschen, die in den Konzentrationslagern Zwangsarbeit leisten mussten, wurden kaum entschädigt. Die Anerkennung des Völkermords ist erst 1982 erfolgt. Das liegt vielleicht auch daran, dass Sinti und Roma kaum eine Lobby hatten. Sie hatten nicht genügend Fürsprecher in der Öffentlichkeit, die auch international Druck gemacht hätten, damit wir uns damit auseinandersetzen.
Deswegen werden sie nun bewusst in den Fokus gerückt?
Als Landtag von Baden-Württemberg wollen wir aller Opfer gedenken, stellen aber jedes Jahr eine Opfergruppe in den Mittelpunkt. In diesem Jahr sind es die Sinti und Roma. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Artikel 3 des Grundgesetzes verbietet Benachteiligung aufgrund von Herkunft, Ethnie, Religion. Wir dürfen nicht vergessen, woher das rührt. Das steht deswegen im Grundgesetz, weil wenige Jahre zuvor Menschen aus genau diesen Gründen ermordet wurden. Deshalb gehört für mich beides zusammen: Die Erinnerung und die Mahnung, dass so etwas nie wieder passieren darf – und der Kampf gegen den Rassismus.
Hört man, was Sinti und Roma heute sagen, ist es bis zur gleichberechtigten Teilhabe noch ein weiter Weg. Was denken Sie, wenn junge Menschen berichten, dass sie ihre Identität als Sinti und Roma beispielsweise im Schulalltag lieber nicht offen zu erkennen geben, aus Angst vor Diskriminierung?
Wir sind eben nicht so tolerant und offen, wie wir es manchmal vorgeben. Sinti und Roma sind deutsche Staatsbürger, sie sind ein Teil unserer Gesellschaft. Da kann es doch nicht sein, dass es fast eine Mutprobe ist, zur eigenen Identität zu stehen. Da bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn man sich verleugnen muss, weil man Nachteile befürchtet. Ich habe lernen müssen, dass viele Sinti und Roma Schule als Tatort für Demütigungen, Beleidigungen, für Ausgrenzung erleben. Das finde ich ganz schlimm. Schule soll ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche angstfrei ihre Persönlichkeit entfalten. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir in den Schulen Wissen über Sinti und Roma vermitteln, und dass wir das in den Bildungsplänen verankern.
Warum halten sich Vorurteile über die Generationen so hartnäckig?
Fehlende Begegnungsmöglichkeiten tragen sicher ganz stark dazu bei. Wenn man in seinem eigenen Milieu immer wieder hört: Diese Menschen sind nicht sesshaft, sind kriminell, leben nur in Wohnwagen, klauen Kinder – dann wird das weitergetragen, ohne dass man sich damit intensiv auseinandersetzt. So kommt es, dass noch heute massive Vorurteile herrschen, wie unter anderem die so genannte Mitte-Studie der Universität Leipzig zeigt. Demnach sagt jeder zweite Befragte, er traut Sinti und Roma kriminelle Energie zu. Wenn man sich aber im realen Leben begegnet, wirkt das Vorurteilen am besten entgegen. Darum habe ich großen Respekt vor Menschen, die sich all diesen Vorurteilen entgegenstellen und zu ihrer Identität stehen. Außerdem müssen wir immer wieder unsere Institutionen überprüfen, ob sie wirklich diskriminierungsfrei sind.
Wie meinen Sie das?
Glücklicherweise leben wir in einem freien und demokratischen Rechtsstaat, auf den wir stolz sein können. Aber mir fällt jetzt beispielsweise auch der Fall eines elfjährigen Jungen in Singen ein ...
... der Anfang 2021 von Polizisten in Handschellen abgeführt wurde, nachdem Nachbarn wegen Ruhestörung die Polizei gerufen hatten ...
... ein elfjähriger Junge, das spricht ja Bände! Auf der anderen Seite hat der Rechtsstaat hier ein ganz klares Signal gesetzt und gesagt, wir dulden keinen Rassismus, indem die Staatsanwaltschaft Strafbefehle gegen vier Beamte erlassen hat. Wir müssen also immer wieder schauen, ob die Ausbildung die Menschen, die in den Institutionen des Staates arbeiten – als Lehrkraft, als Polizist oder Polizistin – auf unsere vielfältige Gesellschaft vorbereitet, und ob beispielsweise die Lehrpläne entsprechend gestaltet sind.
Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg 2013 einen Staatsvertrag mit den Sinti und Roma abgeschlossen, der 2018 verlängert wurde. Mit welchem Effekt?
Zunächst einmal war es ein unglaublich wichtiges Signal. Sowohl für die Mehrheitsgesellschaft als auch für die Sinti und Roma: Wir stehen zu Euch, ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft. Es zeigt Wertschätzung und Anerkennung, auch wenn es viel mit Symbolkraft zu tun hat. Es hat sicher nicht sofort in der Fläche etwas bewirkt. Aber an der Universität Heidelberg wurde eine Forschungsstelle zu Antiziganismus eingerichtet. Das ist schon mal ein erster Schritt.
Und was folgt als nächstes?
Wir sollten das Thema in den Bildungseinrichtungen stärker institutionalisieren. Es sollte nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob ein Lehrer sich des Themas annimmt oder nicht. In Hamburg gibt es ein interessantes Modell: Dort kümmern sich Beauftragte in den Schulen gezielt um Kinder aus Sinti- und Roma-Familien. Da geht es nicht nur um Nachhilfe, sondern auch um eine Stärkung des Selbstwertgefühls, um Wertschätzung.
Baden-Württemberg unterhält als einziges Bundesland einen Rat für die Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma. Er berät die Landespolitik bei Angelegenheiten, die die Minderheit betreffen. Wo hat sich der Einfluss dieses Gremiums bemerkbar gemacht?
Auf jeden Fall bei der Einrichtung der bundesweit ersten Antiziganismus-Forschungsstelle in Heidelberg. Und es gibt Fördergelder für Projekte, da spricht der Rat mit. Das sind erste kleine Schritte. Jetzt geht es darum, noch einmal mehr ins öffentliche Bewusstsein zu holen, das Sinti und Roma ein Teil unserer Gesellschaft sind. Sie sind deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Da haben wir noch sehr viele Hausaufgaben zu machen.