Ludwig Becker

Verfolgung
02.05.1937
Becker ist Gewerkschaftssekretär des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV). Im Zuge der Gleichschaltung der Gewerkschaften wird er am 2. Mai 1933 entlassen.
01.09.1939
Becker wird am 1. September 1939 mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verhaftet und in »Schutzhaft« genommen. Für seine Verhaftung werden Becker keine Gründe genannt, es wird keine Anklage erhoben. Becker wird zunächst im Gefängnis Hohenasperg, ab 26. September 1939 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Dort bleibt er bis Mai 1945.
Biografie
1899
Volksschule in Schwäbisch Gmünd
1907
Eintritt in den Deutschen Metallarbeiter-Verband (DMV) und in die Sozialistische Arbeiter-Jugend (SAJ)
Lehre als Juwelier in Schwäbisch Gmünd und Besuch eines Abendkurses an der dortigen Fachschule für Edelmetallindustrie
1910
Eintritt in die SPD
Juweliergeselle in Pforzheim und auf Wanderschaft
1911
Besuch der Arbeiterbildungsschule in Berlin
1913
Militärdienst, ab 1914 Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg
1918
Mitglied des Stuttgarter Soldatenrats
1918
Mitbegründer der KPD
1924
Becker wird wegen seiner illegalen Tätigkeit für die verbotene KPD zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wird jedoch vorzeitig entlassen, weil er in den württembergischen Landtag gewählt wird.
ab 1925
KPD-Parteisekretär in Stuttgart
1926
Mitglied des Gemeinderats in Schwäbisch Gmünd
ab Dezember 1930
Sekretär des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV) in Schwenningen
Ausschluss aus der KPD, daraufhin Eintritt in die Kommunistische Partei-Opposition (KPO)
Juni 1933
Arbeitslos
März 1934
Hilfsarbeiter bei einem Dachdeckermeister in Schwenningen
August 1935
Hilfsarbeiter im Lager einer Uhrenfabrik in Villingen
Januar 1937
Tätigkeit im Lager der Württembergischen Uhrenfabrik Bürk in Schwenningen
1945
Stellvertretender Bürgermeister von Schwenningen, von der französischen Militärregierung ernannt
Beteiligt an der Neugründung der KPD und der IG Metall
1946
Mitglied des Gemeinderats der Stadt Schwenningen und der Kreisversammlung des Landkreises Rottweil
1947
Leiter der IG Metall Württemberg-Hohenzollern
1951
Erneuter Ausschluss aus der KPD
1953
Bezirksleiter der IG Metall Nordwürttemberg in Stuttgart
1955
Eintritt in die SPD
1969
Ruhestand
Literatur
IG Metall Mitteilungen Stuttgart, 1957, Juli, Jahrgang 12, Nr. 7, S. 28.
Ekkehard Hausen, Hartmut Danneck: »Antifaschist, verzage nicht ...!«. Widerstand und Verfolgung in Schwenningen und Villingen 1933-1945, Villingen-Schwenningen 1990, S. 74-76.
Schumacher 1995, S. 9.
Raberg 2001, S. 45.
Theodor Bergmann: »Gegen den Strom«. Die Geschichte der KPD(Opposition), Hamburg 2001, S. 409.
Kühnel 2002, S. 58.
Weik 2003, S. 18.
Weber Herbst 2008, S. 95-96.
Dokumente
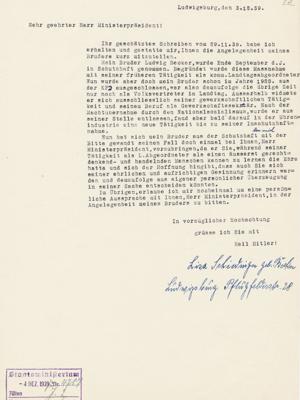
Schreiben von Lisa Schiedinger
Am 3. Dezember 1939 wandte sich Beckers Schwester Lisa Schiedinger an den württembergischen Ministerpräsidenten Christian Mergenthaler mit der Bitte, sich für ihren verhaftete Bruder einzusetzen. Sie hatte jedoch keinen Erfolg: Becker blieb bis zum Ende des NS-Regimes in Haft.